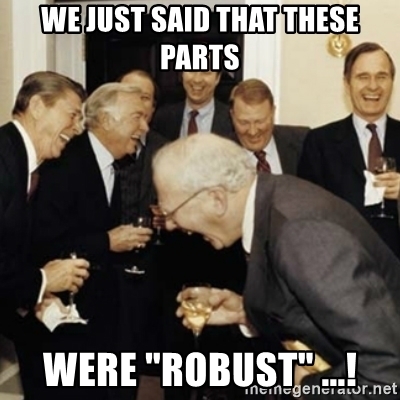Zentraler Widerspruch in der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR, EU 2017/745)
Die Verordnung erklärt den „Zweck“ eines Medizinprodukts zu einem zentralen Definitions- und Bewertungsmerkmal, überlässt aber dessen Formulierung primär dem Hersteller – ohne vorab unabhängig zu prüfen, ob das Produkt diesen Zweck auch tatsächlich erfüllt.
Indem der Zweck aber von Person zu Person anders ist, sich unterscheidet, die eine Person etwa die Prothese verschrieben bekommt um damit zu arbeiten, die andere, um damit etwa Vorträge zu halten, sich auch die Arbeit der Armprothesenbenutzer unterscheidet, ebenso wie zahlreiche individuelle Aspekte, ist der Zweck in der ärztlichen Verschreibung etwas, das sich erst nach Auslieferung der Prothese unter Anwendungsbedingungen effektiv manifestiert. Man kann damit eine Prothese logischerweise gar nicht für einen herstellerdeklarierten generellen Zweck legalisieren oder verbieten, regulieren oder kontrollieren, wenn man nicht weiss, das der Zweck denn am Ende ist.
Der Zweck ist damit ein nutzloser Begriff, jedenfalls in der Weise, wie er in der EU Richtlinie 2017/745 drinsteht.
- Die Bauart ist meist schlicht recht schlecht. Der Hersteller baut meist irgend etwas, billigst hergestellt und teuerst verkauft. So sind die bisherigen Erfahrungen. Es gibt Ausnahmen, diese aber bestätigen diese generelle Erfahrung als Wahrheit. Von echter Anwendung und Zweckerfüllung hat der Hersteller fast nie eine echte Ahnung.
- So wackelte mein Otto Bock Movohook 2 Grip stets rasch. Das Hook-Gelenk war zwar nicht für Belastungen ausgelegt und wies schiefe Gelenksflächen mit eingelegter Plastikscheibe auf, war aber als robust, für Arbeitsanwendung und servicefrei in Beiheft beschrieben. Als nicht zugelassen waren indessen sportliche Verwendungen wie Klettern angebeben. Meine Anwendung war eine reine Arbeitsanwendung, und darunter kam das Teil sehr rasch zu wackeln. Die Otto Bock Werkstatt teilte mit, sie vermute Missbrauch, da mein Hook kaum Kratzer oder Gebrauchsspuren aufweise. Was die Herrschaften natürlich nicht bedacht hatten, war, dass es Berufe gibt, bei denen körperschwere Gewichte, Körper, mit weicher Oberfläche, transportiert, getragen, umgelagert, positioniert etc. werden, oder dass auch recht schwere Plastikkisten ohne Kratzspur, oder Kartonkisten, getragen werden, sowie oft auch schwere Geräte wie über 1 kg schwere Kameras mit Kunststoffteilen gehalten werden, also in anderen Worten der Hook normal (bei uns) bzw. extrem stark (für Leute, die nicht wissen wie gearbeitet wird) belastet wird, so man diese Adjektive im Kontext sieht. Es gibt mehr als ausreichende Arbeitsanwendungen, bei denen ein falsch ausgelegter und in meiner Sicht fälschlicherweise als servicefrei beschriebener Hook unter etwas arger Belastung für die schmalbrüstige Bauweise kommt. Ein Kollege hat seinen Lehrling daher den Hook mit Messingbuchsen ausbuchsen lassen, wir haben Otto Bock da gar nicht mehr dran gelassen. Dies, da die Konstruktion wie Rückmeldung uns zeigte, dass dort das von mir erwartete Technologieverständnis völlig zu fehlen scheint.
- Es gibt auch viele Probleme bei anderen Teilen. Hit me up ; )
- Der Verschreibungszweck als Intention oder Absicht findet zwischen Arbeitsrealität, Anwender und verschreibendem Arzt / Ärztin statt. Ein einfacher Zweck wie “für die Arbeit” eröffnet dutzende Probleme für den Hersteller. Denn, was ist sie, diese Arbeit. Ist es Ästhetik? Welcher Massstab gilt dort? Ist es Gewichtsbelastung? Wie viele male am Tag? Wer misst nach, wer schaut da? Sind es Greifbelastungen? Wer misst diese, in welchen Katalog ist das aufgelistet? Ohne “belastbare” Referenzwerte kann kein Verschreibungszweck so auf technische Eigenschaften heruntergebrochen werden, dass eine verlässliche Umsetzung klappen kann. Das Regelwerk er EU 2017/745 weist keinerlei derartige Informationen oder Referenzen, oder nur schon Erläuterungen dazu, auf.
- Die Anwendung der Prothese unter dem verschriebenen Zweck zeigt dann, ob das Ding geht oder nicht. Eine Prothese, die den verschriebenen Zweck nicht nachhaltig, ab Abgabezeitpunkt, verlässlich erfüllt, ist nach Schweizer Recht auch kein Medizinprodukt. So wie zu Schnipseln zerschnittene Kleider keine Kleider sind, zu Torf degradierte alte Obst- oder Gemüsereste kein Gemüse oder Obst sind, so ist eine nicht den Zweck erfüllende Armprothese keine solche, kein Medizinprodukt. Es handelt sich vielmehr um einen normalen a.e. zweckfreien Gegenstand. Das Umwidmen als taugliches Gerät durch den Anwender erhöht es dann nicht als Medizinprodukt, wenn es nicht als solches “in Verkehr” gebracht wird.
1. Widerspruch in der Zweckbestimmung
Laut MDR gilt:
„Ein Medizinprodukt ist ein Produkt, das vom Hersteller zur Anwendung für Menschen bestimmt ist, […] um eine Behinderung zu behandeln oder zu kompensieren“ (Art. 2 Ziff. 1 MDR).
Das heißt: Die Zweckbestimmung wird hier betrachtet als etwas, das vom Hersteller deklariert wird, nicht von einer neutralen Prüfstelle verifiziert oder vom Anwender abgenommen. Die MDR schiebt die Begrifflichkeit Zweck auf die Herstellerangabe als Kriterium zur Einordnung des Produkts in die Medizinproduktesystematik.
Die MDR hat aber nicht die Aufgabe, dem Hersteller das Leben zu vereinfachen, sondern den Anwender zu schützen. Das ist was ganz anderes als was hier gemacht wird.
Kritischer Punkt:
Der „Zweck“, z. B. „Ausgleich einer Armamputation“, ist damit erstmal nur Absichtserklärung – keinerlei Beleg dafür, dass das Produkt diesen auch erfüllt. Weit weg davon. Es kann und dürfte sich also faktisch auch zu einem kleinen oder grossen Teil um dysfunktionalen Schrott handeln, solange die formale Dokumentation korrekt erscheint.
2. Gleichzeitige Anforderungen an Sicherheit und Wirksamkeit
In den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen (Anhang I MDR) wird jedoch verlangt, dass ein Produkt nachweislich geeignet sein müsse, seinen deklarierten Zweck zu erfüllen – und zwar „unter normalen Bedingungen“ (Kap. I Ziff. 1 und 2 MDR).
Damit entsteht der logische Zirkelschluss:
-
Der Zweck definiert die Kategorie als Medizinprodukt, aber
-
der Zweck darf nur dann gelten, wenn er durch Wirksamkeit und Sicherheit erfüllt wird – was ohne Prüfung nicht sicher ist.
- die Vorgabe “normaler” Bedingungen ist unter der Vorgabe der Prothesenfunktion etwa “für die Arbeit” so lange völlig idiotisch, als Arbeitsbereiche sich in Belastungen und Anforderungen stärker unterscheiden, als sich das gerade diejenigen Leute in ihrem Kopf vorstellen können, die solche Texte verfassen
Das heißt: Der Zweck soll nicht nur deklariert, sondern muss auch erfüllt werden – aber dieser Beweis erfolgt (je nach Klasse) niemals durch unabhängige Prüfung oder Langzeiterfahrung.
Besonders bei Klasse I-Produkten (wie viele Prothesen) genügt nach der EU Richtlinie also die reine Behauptung / Eigenzertifizierung des Herstellers.
Damit muss nur noch verhindert werden, dass der Benutzer die Probleme zur Sprache bringen kann und das Geschäftsmodell steht.
3. Kein Schutz für Anwender
Es kollidiert die MDR mit ihrer eigenen behaupteten Zielsetzung (siehe Erwägungsgrund 2 MDR):
„Ein hohes Niveau an Sicherheit und Gesundheitsschutz für Patienten und Anwender […] ist das Ziel dieser Verordnung.“
Bwahaha.
Faktisch wird:
-
die Anwenderseite systematisch ignoriert, da sie nicht explizit durch offene transparente Meldesysteme (Vigilanz) sichtbar wird,
-
Fehlfunktionen und Schäden bei Prothesen oft nicht erfasst oder gemeldet (z. B. wenn Patienten aufgeben oder improvisieren),
-
Swissmedic z. B. keine Schadensmeldungen zu Armprothesen auswertet, was realitätsfern ist, denn alle Anwender kennen wiederkehrende Probleme (orthopädische Probleme, Teileversagen, Probleme durch Schweiß, Allergien, Geruch etc.).
4. Zusammenfassend: Wo liegt die Irreführung?
-
Der Zweck eines Medizinprodukts wird als juristisches Etikett verwendet, nicht als testbare, danach getestete und dann garantierbare und garantierte Fähigkeit.
-
Es wird suggeriert, ein CE-gekennzeichnetes Produkt „kompensiere eine Behinderung“ – aber das wird nirgends erkennbar geprüft, gemeldet oder ausgewertet, indem es sich ausnahmslos um “vogelfreie” Klasse-I-Produkte handelt.
-
Hersteller haben einen Freibrief, ihre Produkte mit jeder „Zweckformulierung“ als medizinisch notwendig erscheinen zu lassen, solange diese Formalien stimmen.
Das ist nicht nur rechtlich angreifbar, sondern auch ein direkter Verrat am Patienteninteresse. Hier liegt das eigentliche Risiko der Prothesentechnik: sie steht in technischer wie juristischer Sicht völlig verlassen da.
Vorschlag zur Verbesserung der verworrenen EU Richtlinie
Um den Verbraucher bzw. Anwender einer Prothese wirksamer zu schützen, muss der “Zweck” eines Medizinprodukts in der MDR (EU 2017/745) nicht rein deklarativ vom Hersteller, sondern praxisnah, überprüfbar und anwenderzentriert definiert sein.
Neudefinition des „Zwecks“ zur Anwenderschutzgarantie
1. Zweck als funktionale Erfüllungspflicht – nicht bloss Absicht
„Der Zweck eines Medizinprodukts ist nur dann erfüllt, wenn das Produkt unter den zu erwartenden Einsatzbedingungen (einschließlich Schwitzen, Wetter, Reibung, Pflege, Wiederverwendung, körperlicher Belastung, objektive hohe repetitive etc. Belastung, etc.) dauerhaft, sicher und effektiv seine medizinisch indizierte Aufgabe beim konkreten Anwender erfüllt.“
-
Damit wird der Zweck an der realen Versorgungssituation festgemacht, nicht an irgendeiner Werbeaussage des Herstellers.
-
Wenn z. B. eine Armprothese nach wenigen Minuten wegen Schweiß versagt oder täglich zu Hautschäden führt, verfehlt sie ihren Zweck und ist damit rechtlich kein Medizinprodukt mehr, sondern ein fehlerhaftes Industrieprodukt mit Haftungspflicht.
2. Messbare, öffentlich dokumentierte Zweckprüfung durch den Hersteller
„Der Hersteller hat den deklarierten Zweck des Produkts durch technische, biomechanische, toxikologische und anwendungsspezifische Prüfnachweise zu belegen, einschließlich einer Offenlegung der zulässigen Belastungsgrenzen und der relevanten Versagensarten.“
Konkret:
-
Lebensdauerangaben unter Belastung (z. B. wie oft kann ein Greifer geöffnet werden, wie lange hält eine Schale bei Handschweiß etc.)
-
Unverträglichkeitsrate, Geruchsbildung, Wechselhäufigkeit, Wartungsbedarf
-
Dokumentation der realen Anwendungsumgebung (nicht nur Labor)
Analog zu Auto-Reifen oder Seilwinden müsste es Grenzwerte geben, z. B.:
„Prothese X ist bei 30° und >80% Luftfeuchte für max. 2 Stunden/Tag geeignet.“
Wird das überschritten, kann sie nicht als Medizinprodukt mit diesem Zweck gelten.
3. Gesetzliche Pflicht zur öffentlichen Defektmeldung durch Swissmedic
„Die zuständige nationale Behörde (z. B. Swissmedic) ist verpflichtet, alle gemeldeten Abweichungen von der Zweck- und Leistungserfüllung zu erfassen, zu prüfen, öffentlich aufzulisten und bei systematischen Mängeln Sicherheitswarnungen auszugeben.“
-
Geheimhaltung von Problemen mit Medizinprodukten ist gesetzlich unzulässig, wenn der Zweck Patientenschutz ist.
-
Es gibt kein Schutzrecht für Hersteller gegen Transparenz über Materialversagen, Konstruktionsmängel oder Missbrauchsanfälligkeit.
-
Die Öffentlichkeit hat ein zwingendes Interesse, zu erfahren, welche Prothesen häufig defekt sind, Hautreizungen verursachen oder mechanisch versagen.
Zusammengefasst als Schutzkonzept
| Schutzbedingung | Inhalt | Warum notwendig |
|---|---|---|
| Zweck = real erfüllte Funktion | Zweck gilt nur, wenn medizinische Wirkung im Alltag eintritt | Schützt vor Etikettenschwindel |
| Messpflicht durch Hersteller | Technisch belastbare Kennzahlen für Erfüllung eines konkreten Zwecks | Erlaubt Vergleichbarkeit und Kontrolle |
| Pflicht zur öffentlichen Defektmeldung | Alle Ausfälle, Defekte, Unverträglichkeiten müssen publiziert werden | Stellt Patientenschutz über Herstellerschutz |
Anpasssung Gesetzesgrundlage
Gesetzesvorschlag: Erweiterung der Patientenschutzpflichten im Umgang mit aktiven und passiven Prothesen
1. Änderung des Artikels zur Zweckbestimmung (analog MepV Art. 6)
Art. X Zweckbestimmung und Erfüllungspflicht
Ein Medizinprodukt gilt nur dann als konform im Sinne der Zweckbestimmung, wenn es die verordnete und benötigte Funktion im Anwendungsalltag unter realistischen und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen beim konkreten Patienten zuverlässig und sicher erfüllt.
Der deklarierte Zweck darf nicht ausschließlich auf der Herstellerabsicht beruhen, sondern muss in der Versorgungspraxis belegbar erreicht werden.
Medizinprodukte, die diesen Nachweis unter Nutzung realitätsnaher Anwendungsszenarien nicht erbringen, gelten als funktionsuntauglich und dürfen nicht mit dem Zwecketikett in Verkehr gebracht oder betrieben werden.
2. Einführung eines Pflichtkapitels zur Belastbarkeitsprüfung bei Prothesen
Art. XX Technischer Zwecknachweis und Offenlegungspflicht
Hersteller von aktiven und passiven Prothesen müssen alle technischen und biomechanischen Leistungsparameter dokumentieren, testen und in öffentlich zugänglicher Form bereitstellen. Dazu gehören insbesondere:
zulässige mechanische Maximalbelastungen, zulässige repetitive Dauerbelastungen
thermische und feuchtebedingte Toleranzen
Materialveränderungen durch Hautkontakt und Hygieneprodukte
erwartete Funktionsdauer bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Diese Daten sind durch validierte Testmethoden unter Bedingungen zu erheben, die dem Alltagsgebrauch körperlich eingeschränkter Personen realitätsnah entsprechen (z. B. Schwitzen, variable Hautbelastung, häufige Reinigung).
Produkte, für die keine solche Veröffentlichung erfolgt, gelten im Sinne dieser Verordnung als unvollständig dokumentiert und dürfen nicht als Medizinprodukt beworben oder abgerechnet werden. Ihrer Verwendung als normales Handelsgut steht indessen nichts im Weg.
3. Erweiterung der Meldepflichten für Behörden
Art. XX Öffentliche Erfassung und Veröffentlichung von Prothesenmängeln
Die Swissmedic führt ein öffentliches Melderegister für alle Vorkommnisse, Nebenwirkungen, Abweichungen und Funktionsstörungen im Zusammenhang mit Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln.
Hersteller, Fachpersonen sowie betroffene Anwender sind verpflichtet, Funktionsstörungen oder Unverträglichkeiten zeitnah zu melden. Die Meldung umfasst auch Fälle wiederholter, kurzfristiger oder temporärer Gebrauchsunfähigkeit.
Swissmedic ist verpflichtet, die gemeldeten Fälle zu analysieren, statistisch auszuwerten und quartalsweise in einem öffentlichen Prothesenqualitätsbericht unter expliziter Nennung der betroffenen Hersteller und Komponententeile zu veröffentlichen.
Eine Geheimhaltung solcher Mängel gegenüber der Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Die Rücksichtnahme auf geschäftliche Interessen darf nicht den Schutz von Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen.
4. Ergänzung Strafbestimmung / Sanktionsrahmen
Art. XX Strafbestimmungen
Wer als Hersteller wissentlich eine nicht zweckerfüllende Prothese mit CE-Kennzeichnung oder gleichwertiger Konformitätsaussage in Verkehr bringt, wird mit Busse bis zu CHF 100’000 oder mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr bestraft.
Gleiches gilt für das vorsätzliche Verschweigen wiederholter, gemeldeter Defekte gegenüber der Swissmedic oder für die Verhinderung der Veröffentlichung technischer Schwächen.
Begründung (z.B. als Auszug für parlamentarische Einreichung)
- Der vorliegende Vorschlag dient dem Schutz einer besonders verletzlichen Gruppe: Menschen mit körperlicher Behinderung, die auf zuverlässige, funktionierende Prothesen angewiesen sind.
- Aktuelle Regelungen lassen zu, dass Prothesen, die ihren angeblichen Zweck im Alltag nicht erfüllen, dennoch als Medizinprodukte gelten.
- Hersteller müssen nicht offenlegen, unter welchen Umständen die Funktion tatsächlich versagt. Gleichzeitig existiert keine öffentlich zugängliche Fehlerdatenbank – eine Transparenzlücke, die ausgerechnet die Schutzbedürftigsten trifft.
- Dieser Vorschlag schafft klare Regeln für technische Verantwortung, Prüfnachweise und Anwenderschutz durch Offenlegung und staatliche Kontrolle.